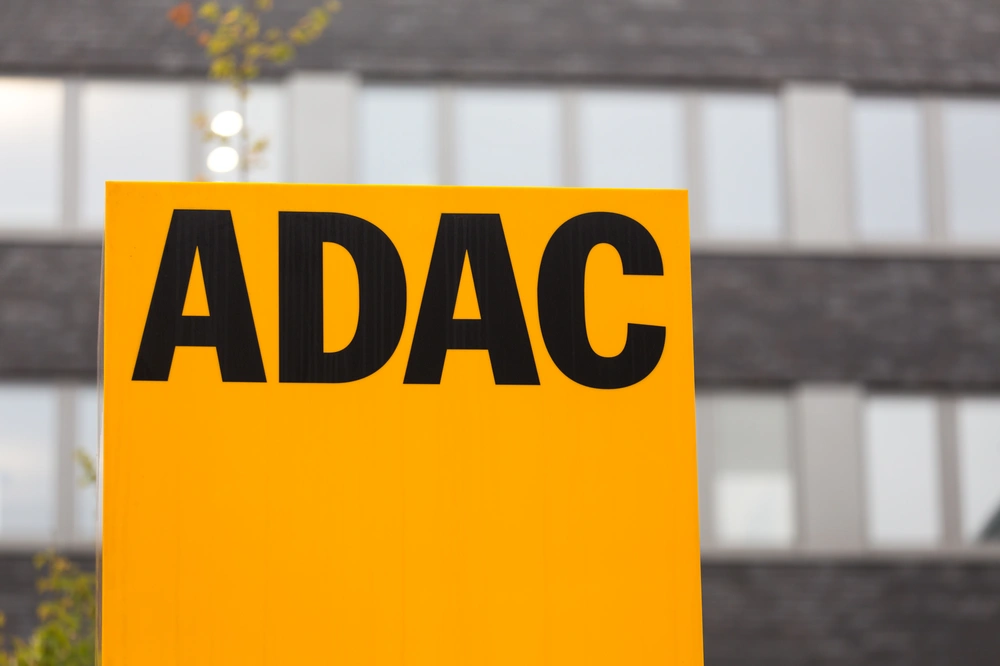Inhaltsverzeichnis:
Baden-Württemberg verfehlt Verkehrswende-Ziele bei E-Mobilität
Nach einer Analyse von SWR-Datenjournalisten auf Basis der aktuellen Neuzulassungs- und Bestandsdaten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wird Baden-Württemberg seine selbst gesteckten Ziele für die Verkehrswende deutlich verfehlen. Die Landesregierung hatte sich vorgenommen, bis 2030 einen E-Auto-Anteil von 50 Prozent auf den Straßen zu erreichen. Auch das weniger ambitionierte Bundesziel von etwa 30 Prozent E-Anteil wird nach aktuellem Trend nicht erreicht. Prognosen gehen davon aus, dass der Anteil an E-Autos 2030 lediglich bei 10 Prozent liegen könnte.
Die Entwicklung der Neuzulassungen von E-Autos verläuft schleppend. Nach dem abrupten Ende des Umweltbonus Ende 2023 ist der Absatz von Elektroautos deutlich eingebrochen. Besonders in den Landkreisen Böblingen und Stuttgart ist der Anteil an E-Autos mit jeweils sechs Prozent am höchsten, was vor allem auf gewerbliche Autoflotten zurückzuführen ist. Am unteren Ende der Skala stehen die Landkreise Heidenheim, Main-Tauber und Neckar-Odenwald mit jeweils unter drei Prozent E-Auto-Anteil.
Obwohl in Baden-Württemberg vielerorts ausreichend Ladesäulen vorhanden sind – im Schnitt alle 2.000 Meter eine –, gibt es weiterhin Hürden wie unübersichtliche und teure Ladeangebote. Laut Professor Henrik te Heesen vom Umwelt-Campus Birkenfeld ist die Ladeinfrastruktur in Städten besser als auf dem Land, was die Kaufzurückhaltung in ländlichen Regionen erklärt. Der Verkehrssektor ist seit Jahrzehnten für hohe CO2-Emissionen verantwortlich und hat diese kaum reduziert. Die Landesregierung setzt auf die Umstellung auf vollelektrische Autos, doch die Maßnahmen zeigen bislang wenig Wirkung.
Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne): „Es ist eine frustrierende Erkenntnis, dass wir trotz der vielfachen Maßnahmen nach dem Projektionsbericht die Ziele einfach nicht erreichen.“
Die Landesregierung richtet ihre Fördermaßnahmen vor allem an Unternehmen, während 88 Prozent aller Fahrzeuge in Deutschland privat genutzt werden. Die Zukunft der E-Auto-Förderung ist ungewiss, da die Bundesregierung bislang keine konkreten Programme für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen vorgestellt hat. Professor Martin Doppelbauer (KIT) kritisiert die Fokussierung auf Dienstwagen und Hybride, da diese in der Praxis kaum CO2-Einsparungen bringen.
Um das Bundesziel zu erreichen, müssten heute bereits sieben Prozent der Autos vollelektrisch fahren, tatsächlich sind es 2024 nur vier Prozent. Der Anteil der vollelektrischen Neuzulassungen müsste bis 2030 auf über 90 Prozent steigen, liegt aktuell aber nur bei 17 Prozent. Die Debatte um das Verbrenner-Aus und die Unsicherheit bei Förderungen verunsichern Verbraucher zusätzlich.
- Prognose für 2030: nur 10 % E-Auto-Anteil in BW
- Aktueller Anteil vollelektrischer Neuzulassungen: 17 %
- Notwendiger Anteil für Zielerreichung: über 90 % bis 2030
- Höchste E-Auto-Anteile: Böblingen und Stuttgart (je 6 %)
- Geringste E-Auto-Anteile: Heidenheim, Main-Tauber, Neckar-Odenwald (je unter 3 %)
Infobox: Baden-Württemberg droht, sowohl die eigenen als auch die Bundesziele für die Verkehrswende deutlich zu verfehlen. Hauptgründe sind das Ende des Umweltbonus, eine zu geringe private Nachfrage und Unsicherheiten bei der Förderung. (Quelle: Tagesschau.de)
Wohlfahrtsverbände fordern gezielte Unterstützung für E-Mobilität
Eine aktuelle Befragung unter 180 Mitgliedsorganisationen der deutschen Wohlfahrtsverbände zeigt, dass bereits 19 Prozent der Fahrzeuge in deren Fuhrparks vollelektrisch unterwegs sind. Damit liegen die Verbände deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. 60 Prozent der Organisationen haben ein sehr großes Interesse an der Elektrifizierung ihrer Flotte, weitere 26 Prozent stehen der Antriebswende aufgeschlossen gegenüber.
Als größte Hürden nennen die Verbände das fehlende Angebot bezahlbarer E-Fahrzeuge unter 20.000 Euro und den Mangel an eigener Ladeinfrastruktur. In 15 Prozent der Fälle fehlen sogar eigene Stellplätze, sodass Mitarbeitende auf öffentliche Parkplätze ausweichen müssen, oft ohne sicheren Zugang zu Ladepunkten. Die Verbände schlagen vor, Partnerschaften mit (halb-)öffentlichen Einrichtungen wie Rathäusern, Kirchen oder Banken einzugehen, um deren Parkflächen für Ladepunkte zu nutzen. Auch E-Bikes werden als praktikable Alternative im Arbeitsalltag, etwa in der ambulanten Pflege, gesehen und sollten stärker gefördert werden.
Jörg-Andreas Krüger, Präsident des NABU: „Die ambulante Pflege mit ihren zehntausenden Fahrzeugen bietet ein riesiges, bisher unterschätztes Klimaschutzpotenzial auf der Straße. Auch zum Schutz von Umwelt und Natur muss die Bundesregierung dabei unterstützen, dieses Potential auszuschöpfen.“
Eva Welskop-Deffaa, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes: „Unkomplizierte und passgenaue Förderprogramme müssen die Besonderheiten gemeinnütziger Träger berücksichtigen. Entbürokratisierung fängt bei der Ladeinfrastruktur an. Die Strompreisgestaltung ist ein weiterer Hebel, um den schnellen Umstieg der Pflegedienste zu unterstützen.“
Die Wohlfahrtsverbände fordern von der Politik gezielte Unterstützung, insbesondere für die ambulanten Pflegedienste, die mit mehreren zehntausend Fahrzeugen ein großes Potenzial für die Mobilitätswende bieten. Preisgünstige vollelektrische Modelle unter 20.000 Euro werden als entscheidend angesehen, um die Umstellung flächendeckend zu ermöglichen.
- 19 % der Fahrzeuge in Wohlfahrtsverbänden vollelektrisch
- 60 % der Organisationen mit großem Interesse an Elektrifizierung
- Größte Hürden: fehlende günstige E-Autos & Ladeinfrastruktur
- 15 % der Organisationen ohne eigene Stellplätze
- Forderung nach gezielter Förderung und Entbürokratisierung
Infobox: Die Wohlfahrtsverbände treiben die E-Mobilität aktiv voran, fordern aber mehr politische Unterstützung, insbesondere für günstige Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur. (Quelle: ecomento.de)
Unerwartete Nebenwirkungen der E-Mobilität
Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet über die unerwarteten Nebenwirkungen der E-Mobilität. Während die Umstellung auf Elektrofahrzeuge als wichtiger Schritt für den Klimaschutz gilt, zeigen sich in der Praxis auch Herausforderungen und neue Fragestellungen. So wird etwa diskutiert, inwieweit Maßnahmen wie Tempo 30 tatsächlich zur Reduktion von Emissionen beitragen.
Die Einführung von E-Mobilität bringt nicht nur Vorteile, sondern auch neue Anforderungen an Infrastruktur, Energieversorgung und gesellschaftliche Akzeptanz. Die Diskussion um die tatsächlichen Effekte auf die Emissionsbilanz und die Auswirkungen auf das Stadtbild und die Lebensqualität ist weiterhin im Gange.
- E-Mobilität bringt neue Herausforderungen für Infrastruktur und Energieversorgung
- Diskussion um tatsächliche Emissionsreduktion durch Maßnahmen wie Tempo 30
- Gesellschaftliche Akzeptanz und Anpassung sind zentrale Themen
Infobox: Die E-Mobilität wird von vielen als Chance gesehen, bringt aber auch unerwartete Nebenwirkungen und neue Herausforderungen mit sich. (Quelle: noz.de)
Quellen:
- Baden-Württemberg: E-Mobilität: Baden-Württemberg verpasst beide Verkehrswende-Ziele
- Wohlfahrtsverbände setzen auf E-Mobilität, Politik soll gezielt unterstützen
- Autohasser verfluchen sie: die unerwarteten Nebenwirkungen der E-Mobilität
- Rheinland-Pfalz: E-Mobilität: Rheinland-Pfalz droht Verkehrswende deutlich zu verfehlen
- E-Mobilität: Rheinland-Pfalz droht Verkehrswende deutlich zu verfehlen
- Fotostrecke Formel E: Freies Training in Berlin endet mit Crash